Präzisionsinstrumente für schonende Cochlea-Implantation
Die Insertion von CI-Elektroden erfolgt mit dem neuen OTODRIVE – OTOARM System automatisch kontrolliert und besonders behutsam – und bringt damit noch besseren Erhalt des Restgehörs. gehört.gelesen durfte beim Einsatz der Präzisionswerkzeuge in Linz dabei sein.
Eva Kohl

Es ist kurz vor acht Uhr morgens. Der Operationssaal am Kepler Universitätsklinikum in Linz wird für die erste Operation des Tages vorbereitet. Ein großflächiger Raum mit weißen, glatten Wänden. Pinzetten, Bohrer, Skalpelle – das OP-Besteck liegt sauber sortiert auf rollbaren Metalltischchen, abgedeckt mit grünen Tüchern. Die abwischbaren Sitzflächen einiger am Rand bereitstehender Hocker blitzen in leuchtendem Gelb, Blau und Schwarz auf.
Hauptperson heute ist der kleine Patient auf der Operationsliege, die in der Fachsprache „Tisch“ genannt wird. Er soll heute an beiden Ohren Cochlea-Implantate bekommen. An der Linzer Uniklinik ist das seit vielen Jahren ein Routineeingriff. Der Chirurg Primarius Dr. Paul Martin Zwittag und seine MitarbeiterInnen sind als erfahrenes CI-Team bekannt. Dass der heutige Eingriff trotzdem etwas Besonderes ist, lässt der Metallkoffer im Vorraum erahnen: so groß, dass der kleine Patient selbst darin wohl Platz finden könnte.
In dem Koffer wurde ein neues Operationswerkzeug angeliefert: OTODRIVE ermöglicht besonders langsame, gleichmäßige und präzise Bewegungen, wie sie auch für eine schonende Insertion der CI-Elektrode angestrebt werden. OTOARM ist fix am OP-Tisch montiert und hält eigenständig das OTODRIVE. Das kann der Chirurg mit OTOARM exakt positionieren und das minimale Zittern vermeiden, wie das bei der menschlichen Hand der Fall ist.
Ein taubes Ohr ist noch lange kein totes Ohr

Primarius Dr. Paul Martin Zwittag: „Langsam kontrollierte Insertion ist die beste Möglichkeit, das Restgehör zu erhalten und die anatomische Struktur der Ohrschnecke zu bewahren.“ ©Michal Gajdos
Selbst bei hochgradigem Innenohr-Hörverlust ist die Cochlea voller empfindlicher lebender Strukturen, die nur einen Bruchteil des Durchmessers eines menschlichen Haares ausmachen. Der Erhalt dieser Strukturen hilft, eventuell vorhandenes Restgehör zu bewahren und die späteren Hörerfolge mit CI zu erhöhen.
Wesentlich für den Erhalt dieser intracochleären Strukturen ist einerseits die Ausführung der CI-Elektrode – der österreichische CI-Hersteller MED-EL legt deswegen besonders hohen Wert auf atraumatische Elektroden. Andererseits wesentlich sind chirurgische Faktoren wie Einführbahn und -geschwindigkeit der Elektrode. Die neuen Präzisionswerkzeuge, entwickelt in einer Zusammenarbeit von MED-EL und der Schweizer Firma CASCINATION, sollen die ChirurgInnen in dieser Hinsicht unterstützen.
OTODRIVE ist kaum mehr als sieben Zentimeter lang und wiegt leichte 30 Gramm. Über ein Fußpedal und damit verbundener Softwaresteuerung gibt es dem/r ChirurgIn volle Kontrolle über die Insertion. Der/die OperateurIn kann die Insertionsgeschwindigkeit zwischen 0,1 und 1 Millimeter pro Sekunde steuern: Damit hat die Elektrode in der langsamsten Einstellung volle fünf Minuten Zeit, die rund 30 Millimeter von der Öffnung der Cochlea bis in deren Spitze zu rutschen! So langsam und gleichmäßig – und damit schonend – können keine noch so routinierten ChirurgInnen die Elektrode mit freier Hand führen.
Moderne chirurgische Medizin
Beim HNO-Kongress im Herbst 2024 wurden OTODRIVE und OTOARM erstmals als fertig zugelassene Medizinprodukte in Österreich vorgestellt. KongressteilnehmerInnen konnten OTODRIVE an einem Ohrmodell ausprobieren. Drei Kliniken in Österreich sind an einer wissenschaftlichen Studie beteiligt, bei der OTODRIVE bei Cochlea-Implantationen eingesetzt wird: Die Universitätskliniken in Wien, St. Pölten und Innsbruck. Erste vorläufige Ergebnisse der Studie wurden beim Kongress im Vortragsprogramm gezeigt.
Doch auch schon die Erfahrung mit EAS-Systemen seit 2005 zeigt: Eine langsamere Insertion – wie jetzt OTODRIVE sie in Perfektion ermöglicht – verbesserte die Wahrscheinlichkeit, noch vorhandenes Hörvermögen zu erhalten. Zudem zeigte eine wissenschaftliche Studie[1] in der Schweiz auch, dass Insertionen mit OTODRIVE im Vergleich zum herkömmlichen, rein manuellen Verfahren durchschnittlich um über 60 Prozent weniger Kraft auf die Strukturen des Innenohrs ausüben. Die Studienautoren schreiben: „Die robotisch unterstützte Insertion war auch mit einer signifikanten Reduzierung starker Druckspitzen und einer Reduzierung des intracochleären Druckniveaus um 17 dB verbunden.“ Das entspricht einer Reduktion des Drucks auf 14 Prozent und belegt, wie viel schonender die Insertion mit OTODRIVE ist.
„Wenn neue Techniken die Ohrschnecke besser schonen und damit das Restgehör besser erhalten, bin ich als Chirurg fast verpflichtet, diese Techniken bei meinen PatientInnen anzuwenden.“ Deswegen ist Primar Zwittag überzeugt, dass die Universitätsklinik Linz das System ab sofort selbstverständlich im Spitalsalltag einsetzen soll. „Die moderne chirurgische Medizin wird immer mehr zur Roboter-assistierten Medizin. An dieser Entwicklung teilzunehmen, ist mir wichtig. Als Standort einer universitären Einrichtung ist für uns eine fachlich-medizinische Vorreiterrolle im Land Oberösterreich geboten.“
OP-Beginn: eigentlich Routine
Im Kellergeschoß des KUK-Linz ist im Operationssaal mittlerweile alles vorbereitet. Mit einem kleinen Schnitt mit dem Skalpell beginnt Primar Zwittag die Operation. Von dem Patienten sieht man nur noch den Bereich um das zu operierende Ohr. Der Rest ist mit den im OP allgegenwärtigen grünen, sterilen Tüchern abgedeckt und abgeklebt. Wenige Minuten nach dem sogenannten Hautschnitt rollen zwei OP-Gehilfen das mehrere hundert Kilogramm schwere Mikroskop zum OP-Tisch. Der erste Teil dieser Cochlea-Implantation verläuft wie gewohnt.
Wir vom Redaktionsteam sind nicht die einzigen Beobachter dieser Operation. Auch zwei OP-Praktikantinnen verfolgen gespannt das Geschehen auf Bildschirmen. Die zeigen gestochen scharf, was der Chirurg durch das Mikroskop dreidimensional sieht: Das Implantat liegt an Ort und Stelle, die überschüssige Länge der Elektrode ist fixiert. Nun wird das neue Präzisionswerkzeug in Einsatz genommen: OTOARM wird dank zahlreicher Gelenke so justiert, dass das darauf sitzende OTODRIVE den Bereich beim Ohr erreicht.
„Noch schonender wäre nur, wenn wir gar keine Elektrode mehr bräuchten.“

OTOARM wird dank zahlreicher Gelenke so justiert, dass das darauf sitzende OTODRIVE den Bereich beim Ohr erreicht. ©Michal Gajdos
Primar Zwittag greift mit der speziellen Pinzette am OTODRIVE die Elektrode, die er dann nochmals glatt streicht. Mittels verschiedener Stellschrauben bringt er die Elektrodenspitze in Position und bedient das Fußpedal: OTODRIVE setzt sich ganz langsam in Bewegung und schiebt selbständig die Elektrode in die Öffnung der Hörschnecke. Der Chirurg hat währenddessen beide Hände frei für andere Tätigkeiten im Zuge der OP. So lobt er später: „Mit OTODRIVE kann ich beim Inserieren den Blickwinkel des Mikroskops ändern, ohne dafür die Insertion zu stoppen. Neben dem Vorteil der langsamen Insertion selbst halte ich das für den größten Nutzen.“
Nach etlichen Minuten entfernt der CI-Spezialist die Pinzette vorsichtig, schiebt dann OTOARM zur Seite, verschließt erst die Cochlea und dann mit Gewebestücken die Wundöffnung. Parallel läuft schon die telemetrische Kontrollmessung für das Implantat. „Fertig. Perfekt“, hört man im Hintergrund die Stimme des Technikers.
Ein OP-Gehilfe zweifelt: „Und was macht das neue Ding jetzt eigentlich? Das macht die Insertion ja noch langsamer!“ Der Primar lacht kurz auf: „Meine Frau hat gesagt: Da bekommst du wieder ein technisches Spielzeug.“ Dann wird er wieder ernst und erklärt, warum gerade diese Langsamkeit der große Gewinn ist: „Wenn ich eine Elektrode zu schnell in ein geschlossenes Flüssigkeitssystem wie die Hörschnecke einführe, kann ich mit der Druckwelle großen Schaden anrichten. Langsam kontrollierte Insertion ist die beste Möglichkeit, das Restgehör zu erhalten und die anatomische Struktur der Ohrschnecke zu bewahren.“
„Meine ethische Verpflichtung: Das Bestmögliche für die PatientInnen bewirken!“
Schon 2013 zeigte eine kooperative Arbeit australischer und deutscher Wissenschaftler[2]: „Eine langsame Insertion der Elektrode erleichtert die vollständige Insertion, verringert den Widerstand beim Inserieren und verbessert den Erhalt des Restgehörs und der Vestibularfunktion“, also: den Gleichgewichtssinn, „nach der Cochlea-Implantation.“ Die untere Grenze für eine kontinuierliche, manuelle Einführung liegt bei rund 52 Millimetern pro Minute, das belegen Ergebnisse einer US-amerikanischen Studie[3]. Versuchen ChirurgInnen manuell langsamer zu inserieren, kommt es zu vielen Unterbrechungen dieser Insertionsbewegung und sogar zum kurzzeitigen Zurückziehen der Elektrode – was eine schonende Insertion konterkariert. OTODRIVE hingegen kann in der langsamsten Einstellung die CI-Elektrode sogar nur sechs Millimeter pro Minute vorwärts schieben.
Mit der telemetrischen Messung ist die Implantation faktisch abgeschlossen. Während Primar Zwittag die Operationswunde vernäht, bereitet die OP-Schwester auf einem frisch überzogenen Instrumententisch schon das OP-Besteck für die Implantation der zweiten Seite vor. In einem Punkt hat der OP-Gehilfe aber recht: Der Eingriff hat etwas länger gedauert als von herkömmlichen Cochlea-Implantationen gewohnt.
„Auch wir lernen noch“, schmunzelt der Primarius. „Nur ein Chirurg, der die jeweilige OP-Technik kennt und kann, geht damit auch zum Patienten oder zur Patientin. Aber Geschwindigkeit und flüssige Abläufe in der Chirurgie kommen trotzdem nur mit der Routine. Das betrifft auch den Umgang mit OTODRIVE.“ Der zusätzliche Geräteaufbau und die besonders langsame Insertion werden immer zusätzliche Zeit kosten. „Aber wenn ich dem Patienten oder der Patientin damit fünf Prozent mehr Restgehör erhalten kann, können zehn oder 15 Minuten längere OP-Zeit keine Diskussion sein“, versichert der Mediziner. „Fünf Prozent können für hochgradig hörbeeinträchtigte Menschen nämlich die Welt bedeuten!“
_______________
[1] Aebischer, P. et al. Quantitative in-vitro assessment of a novel robot-assisted system for cochlear implant electrode insertion. Int J CARS (2024). https://doi.org/10.1007/s11548-024-03276-y
[2] Rajan GP; Kontorinis G; Kuthubutheen J; The Effects of Insertion Speed on Inner Ear Function during Cochlear Implantation: A Comparison Study, Audiol Neurotol (2012) 18 (1): 17–22, https://doi.org/10.1159/000342821
[3] Kyle Kesler K, Dillon NP, et al. Human Kinematics of Cochlear Implant Surgery: An Investigation of Insertion Micro-Motions and Speed Limitations, Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2017, Vol. 157(3) 493–498, https://doi.org/10.1177/0194599817704391
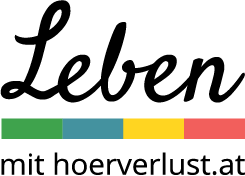
Leben mit hoerverlust.at
Alles auf einen Klick! hoerverlust.at bietet Betroffenen und Angehörigen umfassende Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu allen Bereichen, die Sie auf dem Weg zum Hören benötigen. Mehr zum informativen Wegbegleiter vom ersten Verdacht bis zur optimalen Versorgung finden Sie hier!

ZENTRUM HÖREN
Beratung, Service & Rehabilitation – für zufriedene Kunden und erfolgreiche Nutzer! Mehr zum umfassenden Angebot und engagierten Team des MED-EL Kundenzentrum finden Sie hier!









