Ist Hörverlust bald heilbar?
Prof. Christoph Arnoldner über seine Schwerpunkte als neuer Primar der HNO-Universitätsklinik Wien und über aktuelle Forschungsprojekte, welche die Hörverlust Gentherapie von Grund auf revolutionieren könnten.
Überwiegende Quelle: Podcast „Hörgang“ mit Martin Krenek-Burger

©Adobe Stock
Prof. Dr. Christoph Arnoldner, Experte der Ohrenheilkunde und der Schädelbasis-Chirurgie mit internationaler Ausbildung und Erfahrung, ist vielen CI-NutzerInnen als CI-Experte und -Chirurg bekannt. Seit 2022 leitet er das von ihm gegründete Christian Doppler Labor für Innenohrforschung in Wien. Mit seinem Team erforscht er dort Wirkstoffe für die Behandlung bei Hörstörungen – und auch neue Ansätze der Hörverlust Gentherapie.
MK-B: Sie leiten nun die HNO-Universitätsklinik Wien – welche Schwerpunkte setzen Sie?

Prof. Dr. Christoph Arnoldner, Gründer und Leiter des Christian Doppler Labors für Innenohrforschung in Wien, leitet seit 1. Mai 2025 die HNO-Universitätsklinik Wien. ©MedUni Wien/feelimage
Arnoldner: Ich bin sehr froh, eine Klinik übernehmen zu dürfen, an der wir PatientInnen sehr breit und auf modernstem Stand versorgen können. Wir machen große Operationen bei Tumorerkrankungen, ebenso wie Schönheitsoperationen oder die Wiederherstellung des Hörvermögens mit Cochlea-Implantaten. Wir operieren Kinder wie ältere PatientInnen.
Ein weiterer Schwerpunkt an der Universitätsklinik ist die Ausbildung junger ÄrztInnen. Dazu gehören internationale Fellowship-Programme in Kanada, den USA, Australien und England. Das gesammelte Wissen fließt direkt in die Versorgung unserer PatientInnen ein.
Ganz wichtig ist mir die Forschung – besonders jene Gebiete, die bislang nicht den Stellenwert haben, den sie verdienen. Wir versuchen, durch Kooperationen mit anderen Kliniken die Forschung zu intensivieren. Der Schwerpunkt meiner eigenen Forschung liegt im Hörbereich: mit neuen Substanzen, Implantaten und Gentherapie das Hörvermögen wiederherzustellen.
MK-B: Was macht die Wiener HNO-Klinik aus?
Arnoldner: Wir sind die älteste HNO-Klinik der Welt! Wien – das war Adam Politzer, einer der wichtigsten HNO-Ärzte überhaupt. Und auch das erste mehrkanalige Cochlea-Implantat wurde hier eingesetzt.
Aber wir können nicht nur aus der Vergangenheit leben. Heute gehören wir weltweit zu den führenden Kliniken – sowohl bei der PatientInnenversorgung als auch in der Forschung. Die Hörverlust Gentherapie ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark Wien hier international mitspielt.
MK-B: Ein zentrales Ziel Ihres Forschungslabors ist translationale Forschung – der Übergang von der Forschung in die Praxis.
Das ist unsere Stärke als forschende Kliniker. HNO-Heilkunde ist kein zentrales Fach und beschäftigt sich auch mit sehr feinen Strukturen. Viele Vorgänge – Hörstörungen, Tinnitus, Verlust des Riechsinnes, Allergien – können wir noch nicht zufriedenstellend verstehen. Als Kliniker wissen wir, was das Problem ist. Wir schauen uns das in der Forschung gezielt an und wir tun alles, um das Ergebnis dann rasch an die Klinik zu bekommen.
Es gibt weltweit zirka 1,5 Milliarden Menschen, die an einer Hörstörung leiden – ungefähr so viele wie an Bluthochdruck. Es gibt über 500 Präparate gegen Bluthochdruck, aber kein einziges zugelassenes Medikament, um das Hören wiederherzustellen. Es ist wahnsinnig unzufriedenstellend, wenn wir PatientInnen mit Hörsturz und Tinnitus sagen müssen: „Wir wissen eigentlich nicht genau, was in Ihrem Innenohr gerade passiert.“
Wir wollen besser verstehen, welche Vorgänge bei Hörverlust im Innenohr passieren! Und wir wollen neue Medikamente finden, um unseren PatientInnen etwas anbieten zu können!
MK-B: Gemeinsam mit Ihrem Team forschen Sie unter anderem am Wirkstoff AC102, der bei akutem Hörsturz neue Hoffnung gibt.
Im Moment geben wir bei Hörsturz oder Tinnitus hohe Dosen Kortison – müssen aber sehen, dass die Erfolge oft bescheiden sind. Vor fast zehn Jahren ist eine ganz kleine Pharma-Firma aus Deutschland, ein Spinn-off der Charité, auf uns zugekommen. Die haben uns gebeten, uns deren neuen Wirkstoff anzusehen: das kryptisch klingende AC102 – Anm.: Englisch ausgesprochen als: „A-C-one-O-two.“ – AC steht für „AudioCure“, die Firma hinter diesem Wirkstoff.
Diesen Wirkstoff haben wir in den letzten Jahren von der Petrischale, über Tiermodelle bis jetzt tatsächlich in eine Phase2-Studie gebracht. Das heißt: Jetzt wird dieser Wirkstoff in einer großen Multicenterstudie in vielen Ländern Europas an PatientInnen mit einem akuten Hörsturz getestet. Wir sind großer Hoffnung, dass dieses Medikament tatsächlich die Therapieoptionen nachhaltig verändern könnte.
GG: Warum haben MedizinerInnen denn bisher Kortison gegeben?
Was genau beim Hörsturz im Innenohr passiert, wissen wir bis heute nicht und ist auch eines der Themen, die wir in unserem Labor besser verstehen möchten. Es wird aber vermutet, dass zumindest bei manchen PatientInnen eine Entzündung im Innenohr den Hörverlust auslöst, und da kommt Kortison ins Spiel. Kortison ist letztendlich ein körpereigenes Hormon, das sehr gut entzündungshemmend wirkt, aber es hat keinen positiven Effekt auf die Nervenzellen und -fasern.
MK-B: Worin unterscheidet sich der neue Ansatz?
AC102 wirkt nicht nur entzündungshemmend, sondern schützt tatsächlich auch die Nerven. Hörverlust hat viel damit zu tun, dass die etwa 13.000 mikrometergroßen Sinneszellen im Ohr – einmal geschädigt – nicht mehr nachwachsen. Diese Sinneszellen können wir mit AC102 schützen, speziell den Übergang von der Haarzelle zur Nervenfaser. Das wirkt sich auf Hörverlust und Regeneration aus.
GG: Für bestehende CI-NutzerInnen oder für unversorgte, schon längere Zeit ertaubte PatientInnen wäre das Rückgewinnen der Hörfähigkeit mit AC102 nicht zu erwarten?
Richtig! Wenn AC102 frühzeitig gegeben wird, soll sich das Hören regenerieren, da wie beschrieben ein sehr positiver Effekt auf die Neuronen beobachtet wurde. Zusätzlich schafft AC102 im Rahmen der Cochlea-Implantation das Restgehör viel effektiver als das heute verwendete Kortison zu schützen, was einen entscheidenden Vorteil bringen dürfte.
MK-B: Wie trägt AC102 dazu bei, das Restgehör zu erhalten?
Wir implantieren CIs bei PatientInnen, bei denen Hörgeräte nicht mehr wirken. In den letzten Jahren hat sich aber gezeigt, dass CIs auch PatientInnen helfen, die noch Restgehör haben. Wir wollen dieses Restgehör aber erhalten, weil erhaltenes Restgehör und Cochlea-Implantat gemeinsam besser sind als ein Cochlea-Implantat allein.
Bei der Cochlea-Implantation inserieren wir einen Elektrodenträger in die Hörschnecke. Damit eröffnen wir den „heiligen“ Raum des Innenohrs: Dadurch wird man normalerweise taub. Wir müssen also an Techniken arbeiten, wie wir das Restgehör erhalten können. Dazu zählen feine chirurgische Techniken: Wenn wir die Schnecke besonders vorsichtig öffnen, wenn wir atraumatische Elektrodenträger einschieben, aber auch wenn wir Substanzen verabreichen, welche die Innenohrstruktur schützen.
Da kommt AC102 ins Spiel: Wenn wir einen Fremdkörper ins Innenohr einführen, kommt es unweigerlich zu Entzündungen. AC102 bremst diese Entzündungsreaktion und schützt die Übergänge von den Haarzellen im Innenohr zu den Nervenfasern. Momentan läuft ja die Phase2-Studie an PatientInnen mit Hörsturz. Wenn diese Ergebnisse positiv sind, wird zum einen eine Phase3-Studie folgen, zum anderen wird das Medikament bei weiteren Indikationen geprüft werden – zum Beispiel, um das Restgehör bei der Cochlea-Implantation zu schützen.
MK-B: Seit dem Vorjahr tauchen auch immer mehr Studien auf, dass Gentherapie ein Ansatz bei Hörverlust sein kann.
Bis vor Kurzem haben wir bei PatientInnen mit Hörsturz – Anm.: neben den audiologischen – lediglich bildgebende Untersuchungen gemacht. Nur bei ausgewählten Fällen wurde auch der genetische Hintergrund angeschaut. Heute zählt die Ergründung des genetischen Hintergrunds zu den Standarduntersuchungen. Wir versuchen das gerade wirklich zu etablieren, denn dieser genetische Hintergrund spielt eine große Rolle. Hörverlust ist nicht gleich Hörverlust.
Konkret haben die ersten Kinder mit einer Otoferlin-Taubheit, einer ganz speziellen, angeborenen Hörstörung, eine Gentherapie bekommen und hören nun. (Anm.: Bisher kennen wir über 200 Formen genetisch bedingter Taubheit.1 Otoferlin-Taubheit ist eine davon, mit weltweit rund 200.000 Betroffenen wird sie als nur „selten“ eingestuft. Doch für diese Gruppe Betroffener gibt es nun Hoffnung.)
Kinder mit Otoferlin-Taubheit haben normale Innenohren, normale Haarzellen im Innenohr, aber den Haarzellen fehlt ein einziges Protein: Otoferlin. Dadurch wird der Botenstoff nicht ausgeschüttet, den wir brauchen, um zu hören. Die neue Therapie bringt die fehlende genetische Information in die Haarzellen des Innenohrs, der Botenstoff wird wieder ausgeschüttet und tatsächlich: Diese Kinder hören! – auch ohne Cochlea-Implantat.
MK-B: Wo sehen Sie das größte Potential in der Behandlung von Hörstörungen: in Implantaten, medikamentöser Therapie oder genetischen Modifikationen?
Die Zukunft wird wohl eine Kombination sein. Wir werden weiterhin CIs brauchen, um den vielen PatientInnen helfen zu können. Aber es wird ausgesuchte genetische Formen der Schwerhörigkeit geben, bei denen Gentherapie eine große Rolle spielen wird. Und es wird eine Kombination geben, bei denen wir CI-PatientInnen mithilfe von Gentherapie – die auf die Nervenzellen des Innenohres wirkt – helfen können, mit ihren Implantaten besser zu hören.
Wir bedanken uns bei Martin Krenek-Burger, stellvertretender Chefredakteur der Ärzte Woche, für die spannenden Fragen beim Podcast Hörgang, und besonders bei Prof. Christoph Arnoldner für die Möglichkeit, im Anschluss noch weitere Fragen zu stellen. Außerdem bedanken wir uns beim Verlag Springer-Medizin und seinem Kooperationspartner MedUni Wien, dass wir große Teile dieser Podcast-Folge übernehmen und für unsere LeserInnen adaptieren durften. Das vollständige Gespräch „Hoffnung fürs Hören“ mit Prof. Dr. Christoph Arnoldner finden Sie in der Podcast-Serie Hörgang bei www.springermedizin.at, auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf spektrum.de.
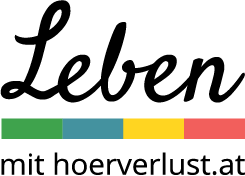
Leben mit hoerverlust.at
Alles auf einen Klick! hoerverlust.at bietet Betroffenen und Angehörigen umfassende Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu allen Bereichen, die Sie auf dem Weg zum Hören benötigen. Mehr zum informativen Wegbegleiter vom ersten Verdacht bis zur optimalen Versorgung finden Sie hier!

ZENTRUM HÖREN
Beratung, Service & Rehabilitation – für zufriedene Kunden und erfolgreiche Nutzer! Mehr zum umfassenden Angebot und engagierten Team des MED-EL Kundenzentrum finden Sie hier!








