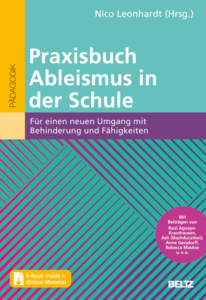Vorurteile und Diskriminierung verhindern Inklusion
Inklusion statt Ausgrenzung: Erfahrungen, Herausforderungen und Lösungen aus dem Alltag von Menschen mit Behinderung
Melanie Fraisl & Markus Fraisl

©Adobe Stock
„Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden“, mit diesem Zitat des deutschen Aktivisten und Moderatoren Raúl Aguayo-Krauthausen beendeten die CIA-Vorstandsmitglieder Melanie Fraisl, Alexander und Matthias Pusker ihren Vortrag über Ableismus bei den CIA Summer Days. Einige Minuten lang beherrschte Stille den Zuschauerraum. Dann zeigten die ersten Wortmeldungen, wie sehr bewusste oder unbewusste Benachteiligung von Menschen mit Behinderung viele der anwesenden CI-Familien betrifft oder betroffen macht.
Melanie Fraisl selbst war als CI-Nutzerin mehrfach mit Vorurteilen und Klischees über Schwerhörigkeit konfrontiert. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit über „Die Rolle der Frau“ stieß die Vortagende auch auf Fachinformationen zum Ableismus, an denen sie beim Vortrag bei den Summer Days die anderen TeilnehmerInnen teilhaben ließ.
Wie Ableismus, Diskriminierung und Inklusion zusammenhängen
Der Begriff Ableismus kommt aus dem angloamerikanischen Sprachgebrauch. Ableismus leitet sich von Ability, auf Deutsch: Fähigkeit, ab – im Gegensatz zur Disability, der Behinderung, und in Parallele zu Sexismus oder Rassismus.
Inklusion beschreibt eine Gesellschaft, in der Menschen unabhängig von ihren körperlichen, geistigen oder psychischen Fähigkeiten gleichermaßen teilhaben können. Nicht, indem sich Einzelne in die bestehenden Strukturen integrieren – vielmehr durch Strukturen, die für jede Person zugänglich und einladend ist. Bestehende Barrieren müssen dazu so gut wie möglich abgebaut werden, die Vielfältigkeit und Einzigartigkeit des individuellen Menschen wird wertgeschätzt.
Ableismus hingegen bezeichnet das Vorurteil behinderten Menschen gegenüber, dass diese weniger wert seien oder allgemein weniger Fähigkeiten als Menschen ohne Behinderung hätten. Daraus resultiert Benachteiligung, auch Diskriminierung genannt: Manchmal offen, wenn Menschen konkret ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Manchmal subtil, wenn Strukturen Barrieren schaffen, die oft nur die Betroffenen selbst wahrnehmen, die ihnen aber – physisch, psychisch oder emotional – die Teilhabe an der Gesellschaft erschweren.
Ableismus ist unsichtbare Diskriminierung
Basierend auf die Einteilung von Personen in „fähig“ oder „nicht fähig“ gelten Menschen ohne Behinderung als „Norm“, Menschen mit Behinderung als „weniger fähig“. Damit verbunden sind auch die beiden Formen von Ableismus:
- die „abwertende“ Form, beispielsweise: „Du hast es nicht so leicht wegen deiner Behinderung“,
- die „aufwertende“, beispielsweise: „Man sieht dir gar nicht an, dass du taub bist“.
Diskriminierung kann auch multipel, also: mehrfach, wirken. Zum Beispiel, wenn Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts, des Alters oder der sozialen Herkunft mit einer Behinderung zusammenkommen: Dann verstärken Sexismus und andere Vorbehalte den Ableismus und es kann vom Ausschluss aus Gruppen bis hin zu strukturellen Formen gehen – bei mangelhafter Barrierefreiheit in Gebäuden, fehlenden Untertiteln und Ähnlichem.
Alltagserfahrungen, die bewegen
Ableismus ist nicht immer leicht zu erkennen, doch Betroffene spüren seine Auswirkungen jeden Tag. Im Zuge des Vortrags erzählte Markus Fraisl über seine Erfahrung mit zusätzlichen Tests im Zuge der Einschulung – allein aufgrund einer Behinderung. Andere Familien behinderter Kinder standen vor der Entscheidung zwischen einer privaten Schule, die sofort Aufnahme signalisierte, und einer öffentlichen Einrichtung, die zunächst Vorbehalte äußerte.
Ein anderer Aspekt von Ableismus: Eine junge Frau, die für alltägliche Handlungen so übermäßig gelobt wurde, als seien Selbstbestimmung und ein eigenständiger Alltag für Menschen mit Behinderung etwas Außergewöhnliches. Besonders bewegend reagierten die ZuhörerInnen auf die Berichte von Spielplatzsituationen: Während Kinder häufig unvoreingenommen aufeinander zugehen, sind es oft die Erwachsenen, die aus Unsicherheit Abstand schaffen – und so Begegnungen verhindern, bevor sie entstehen können.
Den Bildungsbereich im Fokus
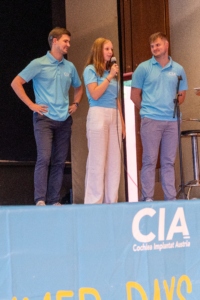
Matthias und Alexander Pusker sowie Melanie Fraisl informieren im Rahmen der Summer Days über Ableismus. ©Carmen Kronawettleitner
Bei den Summer Days in Velden lag ein Schwerpunkt der Überlegungen zu Ableismus und Inklusion im schulischen Bereich. Kinder mit gut entwickelter Lautsprache werden dort häufig als „gleichgestellt“ betrachtet, obwohl sie weiterhin spezielle Unterstützung benötigen.
„Bei Inklusion geht es darum, alle Barrieren in Bildung und Erziehung für alle Schülerinnen und Schüler auf ein Minimum zu reduzieren“, so ein Leitsatz aus einer Handreichung für Lehrkräfte. Gemäß der Aussage „Wer schlecht hört, muss mehr sehen“, können diese Unterstützungen viele Formen annehmen, zum Beispiel:
- Sitzordnung
- Verlängerte Arbeitszeiten bei Prüfungen
- Alternative Prüfungsformen
- Visuelle Hilfen und gute Sicht auf das Mundbild der Lehrkräfte
- Barrierefreie Gestaltung des Unterrichts und der Räumlichkeiten
- Themen und wichtige Punkte an die Tafel schreiben
- Lehrerecho bei Schüleraussagen
Solche Anpassungen sind kein freiwilliges Entgegenkommen des jeweiligen Lehrkörpers, sondern ein Recht – verankert in Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention und aktuell wieder ausformuliert in den neuen Lehrplan-Ergänzungen (die GG berichtete) für betroffene Kinder. Denn Inklusion bedeutet nicht, alle gleich zu behandeln, sondern allen die gleichen Chancen zu ermöglichen.
Positive Beispiele geben Hoffnung
Bei ihren Recherchen traf Melanie Fraisl neben den vielen kritischen Erzählungen auch auf ermutigende Geschichten, die in der von Alexander und Matthias Pusker geführten Publikumsdiskussion durch weitere Beispiele ergänzt wurden: Die Maturantin erfuhr von Lehrkräften, die konsequent auf Barrierefreiheit achten; von MitschülerInnen, die für beeinträchtigte KlassenkollegInnen mitschreiben, damit wichtige Informationen nicht verloren gehen; von SchuldirektorInnen, die in ihrer Schule bauliche Veränderungen vornehmen lassen oder technische Hilfsmittel zur Verfügung stellen, um den Unterricht für alle zugänglich zu machen.
Diese Beispiele zeigen: Inklusion ist kein fernes Ideal, sondern vielerorts bereits gelebte Realität. Sie wird möglich, wenn Offenheit, Wille und Kreativität zusammenkommen. Vor allem im direkten Kontakt zwischen konkreten Menschen entstehen Brücken. Besonders Kinder zeigen uns immer wieder, wie unkompliziert das Zusammenleben sein kann, wenn Erwachsene ihnen nur den nötigen Freiraum dazu geben.
Haltung und Engagement als Schlüsselfertigkeiten
Inklusion ist kein Luxus, sondern ein Grundrecht. Sie ist verankert in der UN-Menschenrechtskonvention, die sich in der Gesetzgebung widerspiegelt – oder das zumindest sollte. Inklusion beginnt aber zuerst in unseren Köpfen und setzt voraus, dass wir hinschauen, zuhören und aktiv handeln. Wer Vielfalt als Stärke begreift, gestaltet eine Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderung nicht nur dabei sind – integriert werden – sondern selbstverständlich dazugehören – inkludiert sind.
Als CIA, als Verein zur Selbstvertretung von CI-NutzerInnen, appellieren wir an alle: Setzen Sie sich für Barrierefreiheit und gegen Vorurteile ein! Im persönlichen Umfeld, in Bildungseinrichtungen, am Arbeitsplatz und in der Politik. Nur wenn wir bereit sind, Strukturen zu hinterfragen und zu verändern, kann echte Gleichberechtigung entstehen. Denn: Wer Inklusion will, findet Wege. Wer sie nicht will, findet Ausreden. Lasst uns also gemeinsam Wege finden!
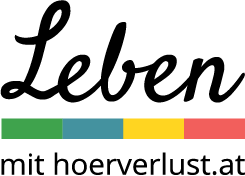
Leben mit hoerverlust.at
Alles auf einen Klick! hoerverlust.at bietet Betroffenen und Angehörigen umfassende Informationen und Kontaktmöglichkeiten zu allen Bereichen, die Sie auf dem Weg zum Hören benötigen. Mehr zum informativen Wegbegleiter vom ersten Verdacht bis zur optimalen Versorgung finden Sie hier!

ZENTRUM HÖREN
Beratung, Service & Rehabilitation – für zufriedene Kunden und erfolgreiche Nutzer! Mehr zum umfassenden Angebot und engagierten Team des MED-EL Kundenzentrum finden Sie hier!